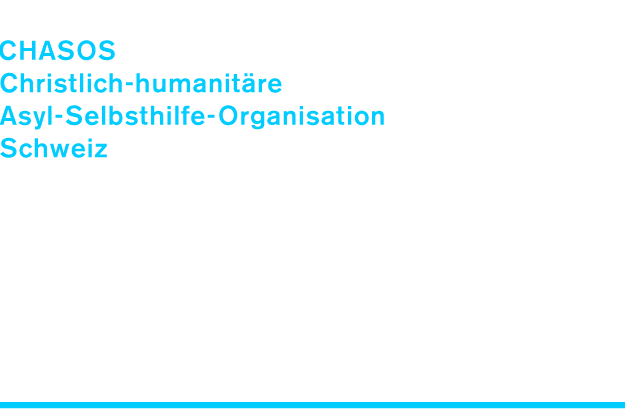
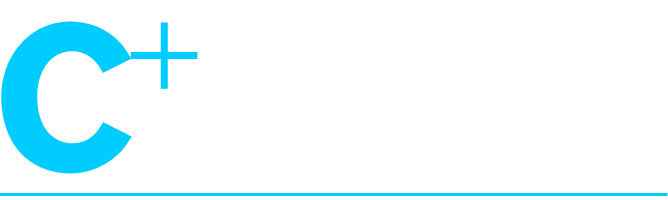
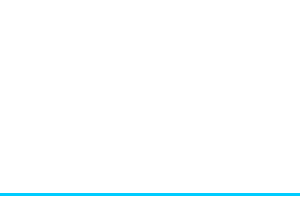
Über uns
Werte
Themen
Kunstverlagerung
Flüchtlingslager
Jeder Schuppen zählt
Spenden
Kontakt
Kunstverlagerung
"Jährlich fliessen 2,24 Milliarden Franken Subventionen in die Schweizer Kultur. Selbst Künstlermillionäre profitieren. Die Kreativität, um an staatliche Geldtöpfe zu kommen, ist beachtlich." (1)
"Künstler, die zu sehr auf staatliche Unterstützung spekulieren, schlaffen ab." (Pipilotti Rist) (2)
Prinzip der Kunstverlagerung
Die Umverteilung von Geld und Ressourcen ist als Solidaritätsprinzip in der Schweiz bestens etabliert: Dass von diesem Prinzip bisher ausgerechnet der Bereich der Kunst ausgenommen wurde, ist aus karitativ-christlicher Sicht eine Unterlassungssünde. Denn noch immer verlocht der Staat jährlich Millionen von Franken für sogenannte Kunstprojekte, Kulturinstitutionen und Kulturschaffende! Dabei stehen Angebot und Nachfrage in keinem Verhältnis zueinander, wir sind längst gesättigt mit Kultur, wir sind überkultiviert bis zum Überdruss. Es ist darum höchste Zeit, dass wir unser Geld und unsere Ressourcen wieder für sinnvollere Sachen einsetzen – z.B. für humanitäre Einrichtungen und Flüchtlingslager.
Kunst früher und Kunst heute
Bis Ende des 19. Jahrhunderts galten als Werke der Kunst, was beim Betrachter sinnliches Wohlgefallen auslöste. Darum heisst es z.B. im Französischen "Les Beaux Arts". Die Ablenkung von den Sorgen des Alltags durch den sinnliche Genuss – dieser reinigenden ("katharsischen") Funktion mass die Gesellschaft eine so wichtige Funktion zu, dass man den Künstlern die sog. Kunst- bzw. Narrenfreiheit zusprach. Das heisst: Sie durften tun und lassen, wie ihnen gefällt – so lange es gefällig blieb.
Ab Anfang des 20. Jahrhunderts wollten sich die Künstler plötzlich nicht mehr an dieses bewährte Abmachung halten. Wie pubertäre Jugendliche begannen sie demonstrativ Werke zu fabrizieren, die nicht mehr schön waren und schon gar nicht gefällig. Sie stellten sie extra schluddrig oder aus minderwertigen Materialien her. Sie erklärten alles sinnlich Reizvolle zum Brechreiz, den Verdruss zum Genuss, den Unsinn zum Sinn, die Nicht-Kunst zur Kunst, das Genie zum Dillettanten und Jedermann zum Künstler. Kurz: Sie stellten alles auf den Kopf und suspendierten damit die Kunst von jeglicher Nützlichkeit. Das war damals vielleicht lustig, war damals vielleicht neu und frech – aber heute?
Förderung der Kunst
Wer findet einen Witz noch glatt, der ihm zum abertausendsten Mal erzählt wird? Klar, in leichten Varianten und Variationen, mit anderen Windungen und neuen Wendungen – aber im Grunde ist es der immergleiche pubertären Jahrhundertscherz geblieben, den uns die sog. Künstler und Kunstinstitutionen bis heute erzählen.

Heute nicht mehr lustig: Marcel Duchamps
Jahrhundertscherz (1917).
Ob sie den Witz wenigstens selber noch lustig finden, ist fraglich. Der Rest der Menschheit tut es nicht. Längst hat sich das Publikum ausgeklinkt, schaut nur noch stumm und kopfschüttelnd weg, wenn die nächste Kunstausstellung ansteht. Und so generiert die Kunstwelt seit Jahrzehnten keinen anderen Nutzen mehr, als sich selbst am Leben zu erhalten.
Eine traurige Rolle spielen dabei die staatlichen Kulturförderstellen, die mit ihrer fehlgeleiteten Förderpolitik einen wesentlichen Beitrag zur Verschlechterung der Kunst leisten: Systematisch werden in der Schweiz diejenigen "Künstler" mit Auszeichnungen und Preisen belohnt, die notorisch schlechte Kunst produzieren. Die Konsequenz davon ist, dass die wenigen Meister alter Schule, die ihr Handwerk noch beherrschen, nicht beachtet oder gar der Lächerlichkeit preisgegeben werden.
Forderungen an die Kunst
Lange genug hat die Gesellschaft der Entsinnlichung, der Sinn- und Zweckentleerung, der Degeneration der Kunst zugeschaut und dieser Entwicklung mit falschen Anreizen Vorschub geleistet:
Wenn die Kunst keinerlei gesellschaftlichen Nutzen mehr erfüllen will, warum sollte dann die Gesellschaft weiterhin an ihr festhalten?
CHASOS fordert deshalb eine konsequente "Kunstverlagerung" in drei Schritten:
1. Sofortige Suspendierung aller Fördergelder für alle sog. Kunstprojekte, Kulturschaffende und Kulturinstitutionen.
Warum an etwas festhalten, das uns nur noch ärgert, langweilt, nervt? In der heutigen Zeit können wir uns einen solchen "Luxus" nicht mehr leisten! Durch die Streichung sämtlicher Fördergelder werden wir die schlechte Kunst zwar nicht von heute auf morgen los, aber wenigstens ihr ungehemmtes Weiterwuchern können wir so abstoppen.
2. Entrümpelung sämtlicher öffentlicher Kulturinstitutionen.
Es gibt genügend Internet-Börsen, auf denen die Sachen verscherbelt werden können. Angesichts der Sperrigkeit, Stümperhaftigkeit und Hässlichkeit der meisten zeitgenössischen Kunstwerke ist die Frage berechtigt, ob sich dafür Käufer finden werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass man fast jeden Mist an den Mann bringen kann, wenn man nur den Preis genügend tief ansetzt. In manchen Fällen lohnt es sich sogar, die Sachen zu verschenken: Wenn man die Käufer dazu verpflichtet, die Sachen selber abzuholen, lassen sich immerhin die Entsorgungsgebühren einsparen.
3. Umverteilung und Umutzung der frei werdenden Ressourcen für gemeinnützige humanitäre Einrichtungen.
Selbstverständlich müsste diese Umverteilung an Auflagen und Kontrollmechanismen geknüpft sein – die in Frage kommenden Organisationen (IKRK, HEKS, KEH, Caritas, CHASOS, etc.) müssten den Nachweis erbringen, mit ihrem Engagement tatsächlich gesamtgesellschaftlich relevante Aufgaben und Funktionen zu erfüllen. Von den karitativen Organisationen der Schweiz dürfte zum jetztigen Zeitpunkt wohl erst CHASOS dazu in der Lage sein. Ein solches spruchreifes Vorzeigeprojekt ist z.B. das FLÜCHTLINGSLAGER HALLE32.

––
(1) Die Weltwoche; 13.01.2011; Ausgabe-Nr. 02
(2) Die Weltwoche; 13.01.2011; Ausgabe-Nr. 02

